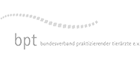Wie die meisten Tiere, die auf einer Wiese grasen, sind auch Pferde immer wieder von Wurmbefall geplagt. Doch nicht nur Tiere auf der Weide, sondern auch solche, die hauptsächlich im Stall gehalten werden, können sich infizieren. Häufig sind die meisten oder sogar sämtliche Pferde des ganzen Pferdebestands betroffen. Um das Risiko von Erkrankungen durch Infektionen mit gastrointestinalen Parasiten zu minimieren, ist eine regelmäßige Entwurmung wichtig.
Grundsätzlich sind Pferde aller Altersgruppen und unabhängig von der Haltungsweise sowie gleich, ob es sich um Freizeit-, Zucht- oder Turnierpferde handelt, ständig in Gefahr, an Wurminfektionen zu erkranken. Zu den häufigsten Wurmarten beim Pferd zählen kleine und große Strongyliden, Spulwürmer, Bandwürmer und Pfriemenschwänze. Darüber hinaus kommen auch Zwergfadenwürmer, Großer Leberegel, Lungenwurm und Magenwürmer vor, sowie als ein weiterer gastrointestinaler Parasit die Dasselfliege.
Kleine Strongyliden
Mit kleinen Strongyliden oder auch Cyathostominen (sogenannte nicht-wandernde/nicht-migrierende Strongyliden) infizieren sich Pferde hauptsächlich auf der Weide, weniger im Stall. Beim Grasen nehmen sie infektionsfähige dritte Larvenstadien (L3) auf, die sich in der Schleimhaut des Verdauungstraktes zum vierten Larvenstadium entwickeln. Dieses gelangt in den Darm, wo es zum sogenannten adulten Stadium heranwächst. Der ausgewachsene Wurm produziert Eier, die vom Wirtstier dann mit dem Kot ausgeschieden werden – woraufhin sich im Freien zunächst im Ei und nach dem Schlupf als frei lebende Larven die Entwicklung zur L3 anschließt, bevor diese beim Grasen aufgenommen wird. So schließt sich der (Entwicklungs-)Kreis.
In der Regel sind kleine Strongyliden im Magen-Darm-Trakt relativ harmlos, doch wenn sehr viele die Darmwand besiedeln, schädigen sie die Schleimhaut. Die Folge: Infizierte Tiere magern ab, leiden an wiederholt auftretendem Durchfall und haben ein erhöhtes Kolikrisiko. Gefährlich werden kann ein Befall mit kleinen Strongyliden vor allem bei jüngeren Pferden bis zu sechs Jahren. In dieser Altersgruppe kommt es vergleichsweise häufig zu dem Krankheitsbild der „larvalen Cyathostominose„. Auch wenn diese in Bezug auf die gesamte Pferdepopulation nur sehr selten vorkommt (genaue Zahlen existieren nicht, aber die Inzidenz liegt vermutlich deutlich unter einem Prozent), ist sie aufgrund des in der Regel schwerwiegenden Verlaufs mit starkem Durchfall, Ödemen, erheblicher Abmagerung und mit einer teilweise über 50-prozentigen Mortalität ein wahres „Schreckgespenst“. Zum Nachweis der Cyathostominen-Infektion bzw. der von den Würmern ausgeschiedenen (Magen-Darm-Strongyliden-)Eier untersucht man Kotproben (sogenannter koproskopischer Nachweis) mittels Flotationsverfahren.
Zur Behandlung von kleinen Strongyliden kommen sogenannte Anthelminthika zum Einsatz. Allerdings haben zahlreiche Populationen der kleinen Strongyliden während der letzten Jahrzehnte Resistenzen gegen einige dieser Medikamente entwickelt. Um diesen Prozess möglichst nicht weiter zu befeuern, sollte man nicht häufiger behandeln als unbedingt nötig. ExpertInnen empfehlen, Fohlen und Jährlinge alle drei Monate gegen kleine Strongyliden zu behandeln, ausgewachsene Pferde etwa ein- bis zweimal jährlich. Bei Letzteren ist auch eine selektive Entwurmung nach Kotprobenuntersuchung bzw. in Abhängigkeit von der Anzahl ausgeschiedener Wurmeier möglich.
Weitere Informationen zu Kleinen Strongyliden
Große Strongyliden
Neben den nicht-wandernden kleinen Strongyliden, gibt es auch die eine Körperwanderung vollziehenden, sogenannten großen Strongyliden (zum Beispiel Strongylus vulgaris). Diese besitzen eine erhebliche Pathogenität und können daher für die Gesundheit der Pferde deutlich gefährlicher werden. Auch diese nehmen Pferde als Larven beim Weiden auf. Bevor die großen Strongyliden ihr eigentliches Ziel im Wirt erreichen – den Dickdarm – und dort zum erwachsenen Wurm heranreifen, durchwandern die Larven je nach Strongylus-Art monatelang entweder intestinale Gefäße oder verschiedene Organe wie Leber, Pankreas oder Niere und schädigen sie dabei. Anzeichen eines Befalls mit großen Strongyliden: Erkrankte Tiere leiden an z. T. hochgradiger Kolik, haben Durchfall, sind schwach und abgemagert und entwickeln teilweise eine Blutarmut. Besonders bei S. vulgaris-Infektionen kann die, aufgrund der Gefäßwandschädigungen entstehende thrombotisch-embolische Kolik, tödlich enden.
Da die Eier der großen und kleinen Strongyliden nicht zuverlässig voneinander unterschieden werden können, ist zur Differenzierung die Anzucht dritter Larven und deren mikroskopische Untersuchung erforderlich.
Auch bei großen Strongyliden sind Anthelminthika weiterhin das wichtigste Mittel in der Bekämpfung. Aufgrund des langen Entwicklungszyklus der Strongylus-Larven von mindestens sechs Monaten sollte zweimal im Jahr mit einem gegen diese Larven wirksamen Präparat behandelt werden, um so die Entstehung adulter Stadien zu vermeiden. Sowohl für große als auch für kleine Strongyliden gilt jedoch, dass ein mindestens einmal wöchentlich durchgeführtes Abäppeln der Weiden zur Reduzierung der Kontamination der Flächen mit infektiösen Larven beiträgt.
Weitere Informationen zu Großen Strongyliden
Spulwürmer (Parascaris equorum und Parascaris univalens)
Vor allem Fohlen und junge Pferde sind oft von den Dünndarm besiedelnden Spulwürmen – auch bekannt unter dem Sammelbegriff Askariden – betroffen. Ausgewachsene Spulwürmer sind gut bleistiftdick und können bis zu 50 Zentimeter lang werden. Da Spulwürmer sehr viele Eier legen, die ein befallenes Pferd wiederum mit dem Kot ausscheidet, kann ein einzelnes befallenes Tier sehr schnell seine ganze Umgebung infizieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die sich in den Eiern entwickelnden Larven sehr widerstandsfähig und sogar frostbeständig sind. Sie können über Monate und sogar Jahre überleben, sodass verunreinigte Weiden und Ställe für Pferde eine ständige Gefahrenquelle darstellen.
Hat ein Tier infektiöse Spulwurmeier aufgenommen, entwickeln sie sich im Darm zu Larven, die über die Blutgefäße in Leber, Herz, Lunge und Kehlkopf gelangen. Vom Kehlkopf aus schluckt das Pferd sie erneut ab. Auf diese Weise gelangen die Larven erneut in den Dünndarm und reifen dort zu ausgewachsenen Würmern heran.
Spulwürmer schädigen auf ihrer Wanderung die Organe. In der Lunge äußert sich das beispielsweise durch Husten, auch bakterielle Infektionen können begünstigt werden. Der Wurmbefall im Dünndarm führt dazu, dass Tiere weniger Appetit haben und abmagern, außerdem wird das Fell rau. Bei massiven Infektionen kann es vor allem bei Fohlen zur vollständigen Verlegung des Darmes und somit zu Koliken kommen, teilweise sogar zur Perforation des Darmes.
Gegen Spulwürmer sind die auch gegen die großen und kleinen Strongyliden verwendeten Anthelminthika wirksam. PferdehalterInnen sollten nicht nur das betroffene Tier, sondern auch alle anderen Tiere gleichen Alters entwurmen. Ab einem Alter von zwei Monaten können Fohlen gegen Spulwürmer behandelt werden, die Behandlung sollte im ersten Lebensjahr etwa alle drei Monate mit unterschiedlichen Wirkstoffen wiederholt werden. Doch Vorsicht: Besonders auf Gestüten haben sich in den letzten Jahrzehnten vermehrt resistente Spulwurmpopulationen ausgebildet, da hier in der Vergangenheit zu häufig behandelt wurde.
Weitere Informationen zu Spulwürmern
Bandwürmer (Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna und Paranoplocephala mamillana)
Die bei Pferden am häufigsten vorkommende Bandwurmart ist Anoplocephala perfoliata. Die Entwicklung dieser Parasiten schließt Moosmilben als Zwischenwirte ein, sodass die Infektion durch Aufnahme dieser mit den Bandwurmlarven infizierten Moosmilben beim Grasen erfolgt. Im Verdauungstrakt wachsen die Larven zu adulten Formen heran. Bei einem starken Befall können sie die Darmwand schädigen, die Kontraktionen vor allem des Blind- und Dickdarms stören und so Verstopfungen bzw. Koliken verursachen.
Bandwurminfektionen lassen sich über Kotprobenuntersuchungen sowie indirekt durch Serum- und Speicheltests nachweisen. Wollen PferdehalterInnen wissen, ob der Bestand betroffen ist, sollte Probenmaterial der gesamten Herde untersucht werden. Bei positivem Ergebnis der Kotprobenuntersuchung sollte man alle Pferde des Bestands entwurmen. Der Wirkstoff der Wahl ist hier Praziquantel.
Grundsätzlich wird auf Betrieben mit Bandwurmvorkommen wenigstens eine Behandlung einmal im Jahr und zwar im Spätherbst oder Winter empfohlen. Je nach Höhe des Risikos für einen Befall im Bestand kann eine weitere Anwendung im Sommer erforderlich sein.
Weitere Informationen zu Bandwürmern
Pfriemenschwänze (Oxyuris equi)
Mit dem Pfriemenschwanz Oxyuris equi können sich Tiere sowohl auf der Weide als auch im Stall infizieren. In der Regel ist der Befall harmlos, in einzelnen Fällen kann es jedoch während der Entwicklung der Würmer zu Entzündungen im Dickdarm kommen.
Einen O. equi-Befall kann man an haarlosen Stellen an der Schweifrübe und Hautirritationen am Anus erkennen. Der Grund: Die ausgewachsenen Würmer legen ihre Eier um den Anus des Pferdes herum ab, was zu starkem Juckreiz führt, so dass sich das Pferd häufig mit der Schweifrübe scheuert. Daher bezeichnet man Oxyuren auch als „Anuswürmer“.
Besteht der Verdacht auf „Oxyuren-Befall“, sollten die Eier der Pfriemenschwänze durch eine Klebestreifenprobe aus dem äußeren analen Bereich des Pferdes nachgewiesen werden. Gut wirksam sowohl gegen ausgewachsene Würmer als auch gegen die verschiedenen Larvenstadien sind Arzneimittel, die makrozyklische Laktone und Benzimidazole enthalten.
Weitere Informationen zum Pfriemenschwanz
Magendasseln/Dasselfliegen (Gasterophilus spp.)
Auch wenn Magendasseln keine Würmer sind, kommt bei einem Befall eine Wurmkur zum Einsatz. Denn die Parasiten nutzen ebenfalls den Magen-Darm-Trakt des Pferds für ihren Lebenszyklus. Je nach Art legen Dasselfliegenweibchen ihre Eier meist an verschiedenen Stellen im Fell des Pferdes ab. Von dort werden sie teilweise durch Ablecken oral aufgenommen und dringen in die Mundschleimhaut ein, von wo sie dann weiter nach distal bis zum Magen oder Darm wandern. Nach einigen Monaten im Darm scheidet das Pferd die Larven aus. Im Erdboden verpuppen sie sich, wachsen zu ausgewachsenen Fliegen heran und legen erneut ihre Eier auf Pferden ab.
Besonders bei starken Infektionen kann es während der Entwicklung der Larven in der Mundschleimhaut zu ausgeprägten Entzündungen kommen. Die am häufigsten vorkommende Art ist Gasterophilus intestinales, die sich als drittes Larvenstadium mit starken Mundhaken ausgestattet in die Magenschleimhaut heftet und dort über Monate verbleibt. Dies führt dort zu kraterförmigen Schädigungen der Schleimhaut und kann zu Inappetenz, Abmagerung und Kolik führen, eine Perforation der Darmwand ist allerdings sehr selten. Bei gering- bis mittelgradigen Infektionen zeigen die betroffenen Pferde in der Regel keine Krankheitserscheinungen.
Hat ein Pferd Magendasseln bzw. ist bekannt, dass diese im Bestand vorkommen, sollten die Pferde im Spätherbst mit makrozyklischen Laktonen behandelt werden. Zusätzlich sollten sie die Fliegeneier im Fell mithilfe eines speziellen Dassel-Messers entfernen und das Fell mit insektizidhaltigem Wasser waschen.
Weitere Informationen zu Magendasseln
Weitere gastrointestinale Parasiten sind
- Zwergfadenwürmer (Strongyloides westeri): Der Zwergfadenwurm kommt besonders häufig bei Saugfohlen vor. Er nimmt unter den Pferdeparasiten eine Sonderstellung ein, da er – anders als alle anderen Pferdewürmer – einerseits als Parasit im Pferdedarm lebt und sich andererseits auch nicht-parasitisch in Erde oder Einstreu vermehren kann.
- Großer Leberegel (Fasciola hepatica): Der große Leberegel kommt hauptsächlich bei Wiederkäuern vor, selten bei Pferden. Wenn doch, dann meist, wenn sich Pferde und Wiederkäuer Weiden teilen.
- Lungenwürmer (Dictyocaulus arnfieldi): Der Lungenwurm zählt zu den Fadenwürmern (Nematoden) und tritt am häufigsten bei Eseln auf, selten auch bei Maultieren und Pferden. Wie beim Leberegel können Übertragungen vorkommen, wenn die unterschiedlichen Wirtstiere dieselben Weiden nutzen.
- Magenwürmer (Trichostrongylus axei, Habronema spp. und Draschia megastoma): Auch der Magenwurm ist ein typischer Wiederkäuer-Parasit, der in Ausnahmen bei gleicher Weidenutzung auf Esel oder Pferde übertragen werden kann.
Weitere Informationen zu Vorkommen, Biologie, Klinik, Diagnose und Therapie der wichtigsten gastrointestinalen Parasiten finden Sie in der ESCCAP-Guideline „Empfehlungen zur Behandlung und Kontrolle gastrointestinaler Parasiten bei Pferden und anderen Equiden“
Stand: Oktober 2019
Foto: Pferdekot mit typischen roten Stadien bestimmter kleiner Strongyliden-Arten (ESCCAP-Empfehlung Nr. 8: Mit freundlicher Genehmigung von A. Schmidt (geb. Meyer), Institut für Tierpathologie, Freie Universität Berlin, Jakub Gawor, Witold Stefanski Institute of Parasitology, Polish Academy of Sciences, Warschau, Polen, K. Seidl, Institut für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin, Freie Universität Berlin)

 Pixabay
Pixabay




 Bild von Peggy Choucair auf Pixabay
Bild von Peggy Choucair auf Pixabay